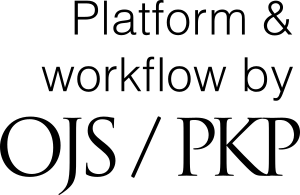Von unreinen Händen und Herzen
Abstract
Wir leben in einer Zeit bedenklicher (und darum auch bedenkenswerter) Umbrüche. Sie vollziehen sich schnell. Und sie wirken sich in unserem Alltag aus.
Nicht nur fußt das Entscheidungsverhalten des Einzelnen inzwischen stark auf seiner momentanen Befindlichkeit. Nicht nur verabschiedet man sich am laufenden Meter von christlichen Prinzipien und dem daraus hervorgehenden Verhalten. Sondern das Vakuum wird in atemberaubender Geschwindigkeit mit einer neuen Hypermoral gefüllt.1 Die Netiquette der neuen Moral zieht sich wie ein unsichtbares Netz immer enger um die Errungenschaft der freien Meinungsäußerung.
Diese Entwicklung wirkt sich auch auf die christlichen Gemeinden aus. Einige Kirchen verstehen sich sogar als Vorreiter und Verbreiter dieser neuen Moral. Alexander Grau beschreibt das Treiben der Kirchen als eine Form der modernen Selbsterlösung. Dieser Form „weltlicher Selbsterlösung haben sich die modernen Kirchen – nicht nur die protestantischen – verschrieben. Denn in einer Welt, in der Moral zur herrschenden Religion geworden ist, muss die traditionelle Religion Moral werden. Damit beschleunigen die Kirchen zwar ihren Untergang als Kultur- und Geistesinstitution, dafür überleben sie als Moralanstalten. Folgerichtig geht es insbesondere den protestantischen Kirchen kaum noch um Glaubensinhalte, sehr wohl aber um politische Korrektheit. "eologische Fragen werden beiseite geschoben. Zum einen, weil führenden Kirchenvertretern zu ihnen nichts intellektuell Anregendes einfällt. Vor allem aber, weil
theologische Fragen kaum in den Nebel des unverbindlichen Sowohl-als-auch aufzulösen sind“2 . Der Verzicht auf den eigenen Standpunkt wird so zum neuen Standpunkt. Dies fordert hohen Tribut. „Wer sich … nicht festlegen möchte, ist nicht theologiefähig. Und wer Angst vor den eigenen Dogmen hat, hat letztlich nichts zu sagen.“3 Die Teilnahme an selbsterlösenden Aktivitäten zur Beruhigung des Gewissens wirke als eine Art aktueller Ablass: „In einem Anfall von beinah neukatholischer Ablassgläubigkeit suggeriert man, man könne das Seelenheil durch gute Taten erlangen, durch Friedensarbeit, soziales Engagement oder Sozialdienste. … Mit größter Lust schmeißt man sich in alle möglichen weltlichen Fragen und beweist sich dadurch seine Modernität. Denn modern sein bedeutet weltlich sein.“4
Dieser Umstand, dass sich die Kirchen als übereifrige Promotoren der neuen Hypermoral betätigen, soll nun anhand eines Textes aus dem Markusevangelium (7,1–13) reflektiert werden.5 Gemäß dem Zeugnis der Kirchenväter war es Markus, der den mündlichen Bericht des Petrus verschriftlichte. Hier gibt er seinen – der jüdischen Gebräuche unkundigen – Lesern einen Einblick in den religiösen „Moralismus“ seiner Tage. Diskussionsgegenstand sind die Reinheitsgebote in Form ritueller Waschungen, die durch die Pharisäer aufgestellt und überwacht wurden und damit den Alltag prägten. Die Pharisäer galten als sehr volksnah und im Gegensatz zu den reichen, politisch einflussreicheren Sadduzäern lehnten sie die übernatürliche Welt nicht ab.6 Markus berichtet: „Es versammelten sich bei ihm die Phari
säer und etliche Schriftgelehrte, die von Jerusalem gekommen waren; und als sie einige seiner Jünger mit unreinen, das heißt mit ungewaschenen Händen Brot essen sahen, tadelten sie es“ (V. 1–2). Hier waren also einige Pharisäer zugegen, verstärkt durch eine Abordnung aus dem religiösen Zentrum Jerusalem, die Jesus und seine Jünger misstrauisch nach Abweichungen von der religiösen Praxis „scannten“.
Welche auch heute noch gültigen Prinzipien können wir in dieser Situation erkennen?
1. Zunächst muss festgehalten werden, dass es in der Torah tatsächlich Reinigungsgesetze gab (siehe 3Mose 11–15). Allerdings werden die Gesetze über reine und unreine Tiere direkt mit der Heiligkeit Gottes und dem Bewusstsein, ein heiliges Volk zu sein, verbunden (3Mose 11,44–45). Und genau dieser Zusammenhang wurde durch die zeremoniellen Waschungen aufgelöst. Die neu entstandenen Vorschriften, welche „die Pharisäer und alle Juden“ (Mk 7,3) einzuhalten pflegten, waren dem eigentlichen Zweck, das Volk Gottes im Alltag an Gottes heiligen Charakter zu erinnern, entfremdet. Gleichzeitig wäre die Entstehung dieser Gebote ohne die Grundlage der alttestamentlichen Gebote undenkbar gewesen.
Ganz ähnlich stellt der Historiker Tom Holland in seinem monumentalen Werk über die Entstehung des Westens, „Herr
schaft“, fest, dass die Agenda der säkularen Elite im Westen ohne die Verwurzelung im Christentum unmöglich gewesen wäre. Die MeToo-Bewegung sucht „den marginalisierten und verwundbarsten Frauen eine Stimme zu geben“; „Abtreibungsbefürworter bezogen sich ebenfalls auf eine tief verwurzelte christliche Vorstellung; dass der Körper jeder Frau ihr gehörte und als solcher von jedem Mann zu respektieren war“; „Unterstützer der Homo-Ehe waren genauso beeinflusst vom Enthusiasmus der Kirche für monogame Treue“. „Der menschliche Körper war kein Objekt, kein Gebrauchsgut, das von den Reichen und Mächtigen benutzt werden durfte, wie und wann es ihnen beliebte. Zweitausend Jahre christlicher Sexualmoral hatten dazu geführt, dass das nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer eine Selbstverständlichkeit war.“7 Ich füge hinzu, dass der neue Moralkodex zwar christlichen Grundprinzipien entnommen wurde. Er wird jedoch durch den Ausschluss Gottes entstellt.
Erkenntnis 1: Wir schaffen uns im Westen eine Welt mit eigenen Gesetzen – die ohne die christliche Prägung jedoch nicht möglich gewesen wäre.
2. Durch die Alltagsvorschriften der Juden zur Zeit Jesu wurde also die ursprüngliche Absicht der Gesetze zunichtegemacht, den Gesetzgeber vor den anderen Völkern zu ehren und groß zu machen. Im 5. Buch Mose – einer Rekapitulation des Gesetzes vor der Landnahme –, kurz bevor dort die Zehn Gebote wiederholt werden, hatte Jahwe auf gerade diesen Zweck hingewiesen: Die anderen Völker sollten zur Frage geführt werden: „… wo ist ein so großes Volk, das so gerechte Satzungen und Rechtsbestimmungen hätte, wie dieses ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege?“ (vgl. 5Mose 4,6–8).
Erkenntnis 2: Durch die Loslösung von Gottes Geboten geht die Kirche an dem zentralen Ziel, den Gesetzgeber zu ehren, vorbei.
3. Im gleichen Zusammenhang in 5. Mose warnte der Gesetzgeber auch: „Ihr sollt nichts hinzufügen zu dem Wort, das ich euch gebiete, und sollt auch nichts davon wegnehmen, damit ihr die Gebote des HERRN, eures Gottes, haltet, die ich euch gebiete“ (5Mose 4,2; vgl. 13,1).
Wir sind in der Regel auf eines von beiden fixiert, entweder auf das Hinzufügen oder auf das Wegnehmen. Doch auch im Fall des Wegnehmens gilt, was der reformierte "eologe Eduard Böhl anmerkte: Es gibt keinen Menschen ohne Gesetz. Deshalb bleibt es nicht beim Wegnehmen der göttlichen Ordnung, das Vakuum muss durch neue Gebote aufgefüllt werden.8
Erkenntnis 3: Das Zu-Gottes-GebotenHinzufügen und das Von-Gottes-GebotenWegnehmen ist oft wechselweise miteinander verbunden, weil Menschen nicht ohne Konventionen für ihr Leben auskommen können.
4. Der Markusabschnitt kreist um Begriffe wie „Überlieferung der Alten“ (V. 3 u. 5), „Menschengebote“ (V. 7) und „Überlieferung“ (der Menschen; V. 8, 9 u. 13). Jesus antwortet darauf mit Jesaja 29,13, wo Lippenbekenntnisse auf Kosten von Herzensgehorsam angeprangert werden. Er kritisiert damit die Umkehrung des Prinzips: Bei der äußerlichen Einhaltung der rituellen Waschungen bleibt die Frage nach den Motiven unbeantwortet.
Erkenntnis 4: Äußeres triumphiert leicht über Inneres. Das Gewicht verlagert sich dann weg vom Herz – der inneren „Schaltzentrale“ – hin zu Äußerlichkeiten. Das ermöglicht es dem Einzelnen, sich eine eigene „Messlatte“ zurechtzulegen, sich mit dieser gut zu fühlen und sich in wohlbegründeten Fällen selbst eine Abweichung zu erlauben.
5. Im Anschluss demonstriert Jesus anhand des fünften Gebots – die Eltern zu ehren – die Verdrehung von Gottes ursprünglicher Absicht. Unter dem Vorwand, bestimmte Weihegaben Gott bzw. dem Tempel zur Verfügung zu stellen, entbanden sich die Pharisäer von der Pflicht, die Eltern im Alter zu versorgen. Jesus bringt mit deutlichen Worten dreimal auf den Punkt, was dabei wirklich vor sich geht: Es bedeutet, das Gesetz Gottes zu „verlassen“ (V. 8), zu „verwerfen“ (V. 9), ja, mit den eigenen Normen das Wort Gottes „aufzuheben“ (V. 13). Indirekt brachten die
Unsere Zeit ist geprägt von der Abschaffung alter Tabus und der Erschaffung NEUER
Hüter der Religiosität so zum Ausdruck, dass ihnen Gottes Gebote nicht genügten.
Erkenntnis 5: Zweitrangiges wird zu Erstrangigem. Damit gilt auch: Erstrangiges verliert seinen zentralen Platz.9 „Wenn wir das Erste in den Mittelpunkt stellen, bekommen wir das Zweite dazu; wenn wir das Zweite in den Mittelpunkt stellen, verlieren wir sowohl das Erste als auch das Zweite.“10
Unsere Zeit ist geprägt von der Abschaffung alter Tabus und der Erschaffung neuer. Erkennbar werden diese neuen Tabus an der Fragestellung: Worüber darf heute nicht mehr kontrovers diskutiert werden? Es gilt heute als Allgemeingut, dass alle Religionen gleich sind. Der Nationalstaat wird als Quelle allen Übels angesehen. Besonders eifrig wird zurzeit an der Abschaffung der Geschlechter gearbeitet. Der ökologische Fußabdruck gewinnt im Gespräch an Bedeutung (etwa wenn mir eine Kollegin verrät: „Ich fahre mit dem Zug nach Wien; einen Flug könnte ich nicht verantworten.“). Schulkollegen meiner Söhne geißeln im Klassenverband den Fleischkonsum. Und ja: Nicht-Geimpfte werden aktuell gern geächtet.
Doch bevor wir selbstgerecht auf andere Selbstgerechte zeigen: Im darauf folgenden Abschnitt zeigt Markus die Quelle der Verunreinigung auf. Es geht um das menschliche Herz. Was „von innen, aus dem Herzen der Menschen“ hervorgeht, verunreinigt den Menschen (Mk 7,21). An erster Stelle nennt Jesus dort die „bösen Gedanken“. Damit sind wir wieder beim Zentrum: Natürlich können uns weder der ökologische Fußabdruck noch die Impfung vor dem gerechten Gott und überweltlichen Gesetzgeber retten. Das überlegene Gefühl, dieses Spiel aus geistlicher Warte durchschaut zu haben und deshalb einer besseren Moral zu folgen, aber auch nicht. Was unsere Herzen betrifft, sitzen wir alle im gleichen Boot – hoffnungslos verloren, wenn wir nicht unseren moralischen Bankrott eingestehen und die Hand des Retters ergreifen.
Diese Ausgabe von Glauben und Denken heute enthält wieder eine Reihe interessanter Beiträge. David Gibson erörtert in seinem Aufsatz Calvins Erwählungslehre, über die übrigens in den letzten Jahrzehnten gar nicht so viel geschrieben wurde, wie manche denken. Markus Till setzte sich in seinem Aufsatz mit der Kanonkritik von Thorsten Dietz auseinander. Es folgen kürzere Artikel von "omas Schirrmacher, Franz Graf-Stuhlhofer, Hartmut Steeb und Dirk Störmer. Ergänzt wird die Ausgabe abermals durch mehrere Rezensionen und Buchhinweise. Ich danke
im Auftrag der Redaktion all jenen, die zum Gelingen dieser Ausgabe beigetragen haben.
Hanniel Strebel
Anmerkungen
1 Vgl. Alexander Grau. Hypermoral. München: Claudius, 2017. Ich habe wesentliche Inhalte in einer Miniserie behandelt. Siehe https://hanniel. ch/?s=hypermoral (Stand: 25.09.2021).
2 Ebd. S. 62.
3 Ebd. S. 63.
4 Ebd. S. 64–65.
5 Einige der Einsichten verdanke ich unserem Pfarrer Florian Weicken, der in einer Reihe durch das Markusevangelium geht: https://zuerichpres.ch (Stand: 25.09.2021).
6 Paulus kalkulierte dies bei seiner Verteidigung mit ein (siehe Apg 23,6–8).
7 Tom Holland. Herrschaft: Die Entstehung des Westens. Stuttgart: Klett-Cotta, 2021. S. 544–
547.
8 Die Politsatire „Der Mann, der Donnerstag war“ des britischen Literaten G. K. Chesterton (1874–1936) bringt dies treffend auf den Punkt. Es geht um Anarchisten, die die staatlichen Gesetze auszuhebeln trachteten. Mit dem ihm eigenen Humor beschreibt Chesterton minuziös die zahllosen Abmachungen und „Gebote“, die sich dieser Kreis zulegen musste, um ein Attentat zu planen. (Gilbert K. Chesterton. Der Mann, der Donnerstag war. Eine Nachtmahr. Vgl. meine Rezension unter https://www.nimm-lies.de/der-mann-derdonnerstag-war-eine-nachtmahr-2/8473 [Stand:
25.09.2021]).
9 Dies hat C. S. Lewis meisterhaft in seinem Aufsatz „First and Second " ings“ beschrieben. Enthalten in: C. S. Lewis. God in the Dock. Grand Rapids: Eerdmans, 1994. S. 278–280.
10 C. S. Lewis an Tom Bede Griffiths. Walter Hooper (Hrsg.) "e Collected Letters of C. S. Lewis, Bd. III: Narnia, Cambridge and Joy, 1950–1963. San Francisco: Harper, 2007. S. 111.
Downloads
Veröffentlicht
Versionen
- 2021-11-19 (4)
- 2021-11-19 (3)
- 2021-11-19 (2)
- 2021-11-18 (1)